Raab, Michael. Elterliche Care-Arrangements in konsensuell-nichtmonogamen Beziehungsnetzwerken. In: Peukert, Almut; Teschlade, Julia; Wimbauer, Christine; Motakef, Mona; Holzleithner, Elisabeth (Hrsg.). GENDER-Sonderheft 5. Elternschaft und Familie jenseits von Heteronormativität und Zweigeschlechtlichkeit. Opladen (Budrich), S. 156-171
Zusammenfassung: Der Artikel stellt auf der Basis von sieben Interviews aus einem Gesamtsample von 13 Interviews einer qualitativen Studie elterliche Sorge in konsensuell-nichtmonogamen Be-ziehungsnetzwerken dar und fragt, ob die offen gelebte Nichtmonogamie mit Veränderungen in elterlichen Care-Arrangements einhergeht. Er unterscheidet eine Lebensführung mit paarweiser Elternschaft und eine kollektive Elternschaft von mehr als zwei Erwachsenen. Beide Varianten gehen mit un-terschiedlichen Anforderungen einher: Konsensuell-nichtmonogam lebende Elternpaare können auf vielfältige Unterstützung aus ihren Beziehungsnetzwerken zurückgreifen, was von allen Beteiligten positiv bewertet wird. Eltern bleiben dabei ein enger Kern mit Unterstützer_innen, die keine expansiven Rollen einnehmen. Hegemonialen Normen entsprechend übernehmen Mütter mehr Sorgeverantwortung. Kollektive Mehreltern-Konstellationen hingegen können ihre Praxen nicht aus der Selbstverständlichkeit soziokultureller Wissensbestände heraus begründen und sind dazu gezwungen, ihre familiären Bande in unpassende rechtliche Konzepte zu übersetzen. Dadurch entstehen, was auch an mangelnden Rechtsansprüchen der weiteren Bezugspersonen liegt, Dynamiken, die dazu beitragen, dass auch hier die Mütter die Hauptlast der Erziehung tragen.
Schlüsselwörter: Beziehungsnetzwerke, Care, Elternschaft, Geschlechtliche Aufgabenteilung, Konsensuelle Nichtmonogamie, Patchwork-Familien, Polyamory
PDF (Open Access) beim Verlag
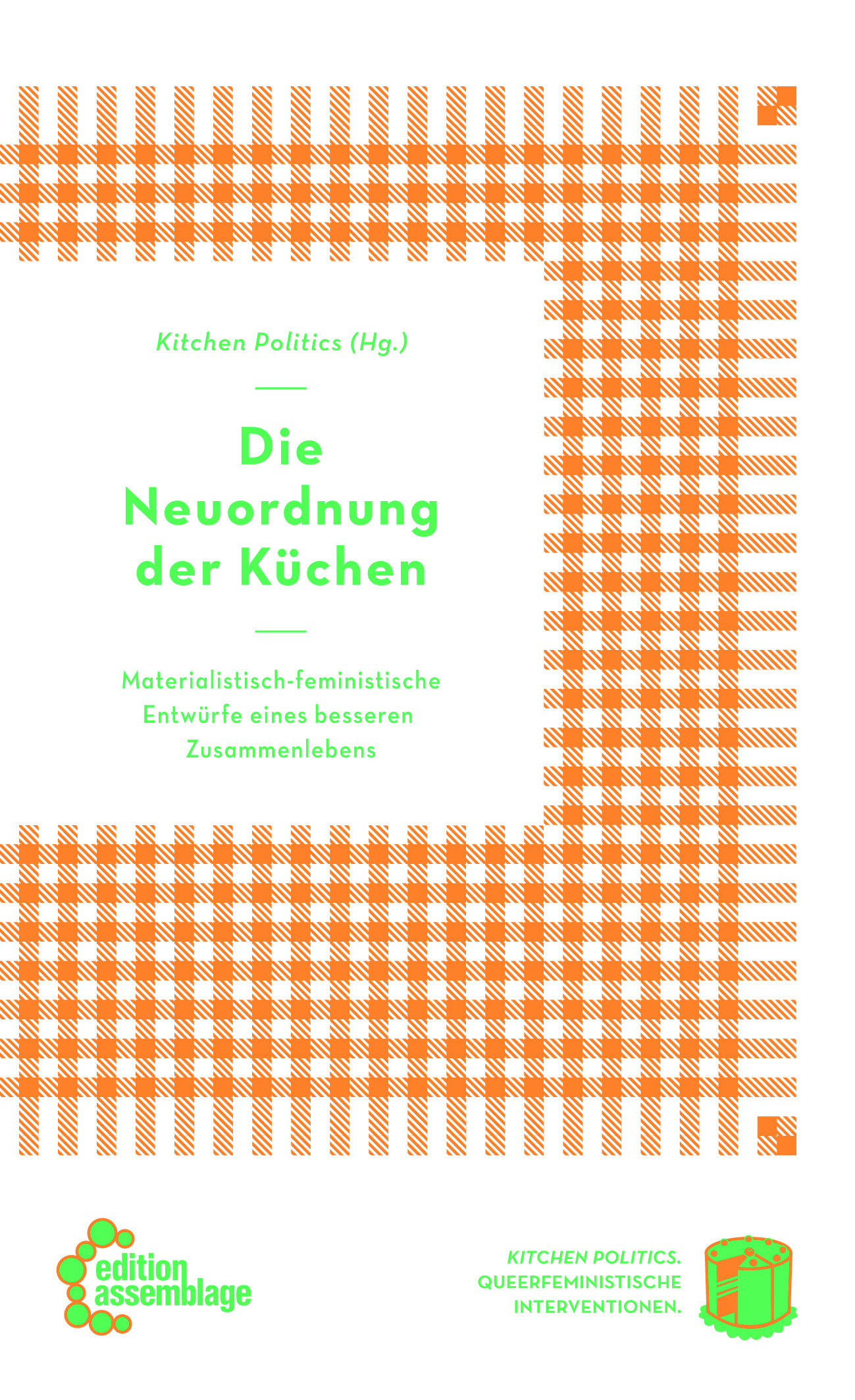 Der Text denkt einen Dialog mit der 2019 leider verstorbenen Genossin Felicita Reuschling weiter. Am Beispiel zweier überlieferter Bilder – dem Narkomfin-Kommunehaus aus der frühen Sowjetunion und dem bekannten Nacktbild der Kommune 1 – geht es um die konkreten Utopien vergangener, teils voluntaristischer, teils technokratischer Entwürfe kollektiver Lebensformen. Und darum, was dieses Erbe linker Bewegungsgeschichte heute bedeuten kann.
Der Text denkt einen Dialog mit der 2019 leider verstorbenen Genossin Felicita Reuschling weiter. Am Beispiel zweier überlieferter Bilder – dem Narkomfin-Kommunehaus aus der frühen Sowjetunion und dem bekannten Nacktbild der Kommune 1 – geht es um die konkreten Utopien vergangener, teils voluntaristischer, teils technokratischer Entwürfe kollektiver Lebensformen. Und darum, was dieses Erbe linker Bewegungsgeschichte heute bedeuten kann.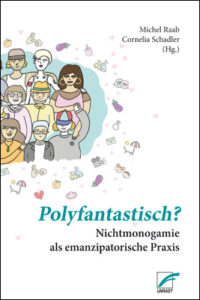 »Wann wird ›She loves you‹ nicht mehr ganz selbstverständlich als ›Sie liebt Dich‹ übersetzt, sondern endlich mal mit ›Sie* liebt euch, yeah, yeah, yeah‹?«
»Wann wird ›She loves you‹ nicht mehr ganz selbstverständlich als ›Sie liebt Dich‹ übersetzt, sondern endlich mal mit ›Sie* liebt euch, yeah, yeah, yeah‹?«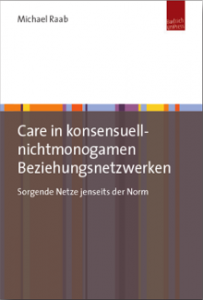 Polyamorie und andere nichtmonogame Beziehungen werden zunehmend sichtbar. Oft werden sie als selbstbestimmtere und geschlechtergerechtere Alternative zu konventioneller Ehe und Familie gesehen. Die marxistisch, feministisch und intersektional fundierte qualitative Studie zeigt, was diese Beziehungsnetzwerke auszeichnet. Gelingt es im Bereich der Sorge (Care), die selbst gesteckten emanzipatorischen Ansprüche umzusetzen?
Polyamorie und andere nichtmonogame Beziehungen werden zunehmend sichtbar. Oft werden sie als selbstbestimmtere und geschlechtergerechtere Alternative zu konventioneller Ehe und Familie gesehen. Die marxistisch, feministisch und intersektional fundierte qualitative Studie zeigt, was diese Beziehungsnetzwerke auszeichnet. Gelingt es im Bereich der Sorge (Care), die selbst gesteckten emanzipatorischen Ansprüche umzusetzen?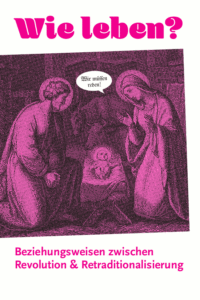 Die Broschüre ist 2018 beim
Die Broschüre ist 2018 beim 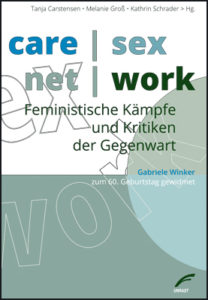 Der Beitrag ist 2016 für einen Sammelband anlässlich des 60. Geburtstags von
Der Beitrag ist 2016 für einen Sammelband anlässlich des 60. Geburtstags von